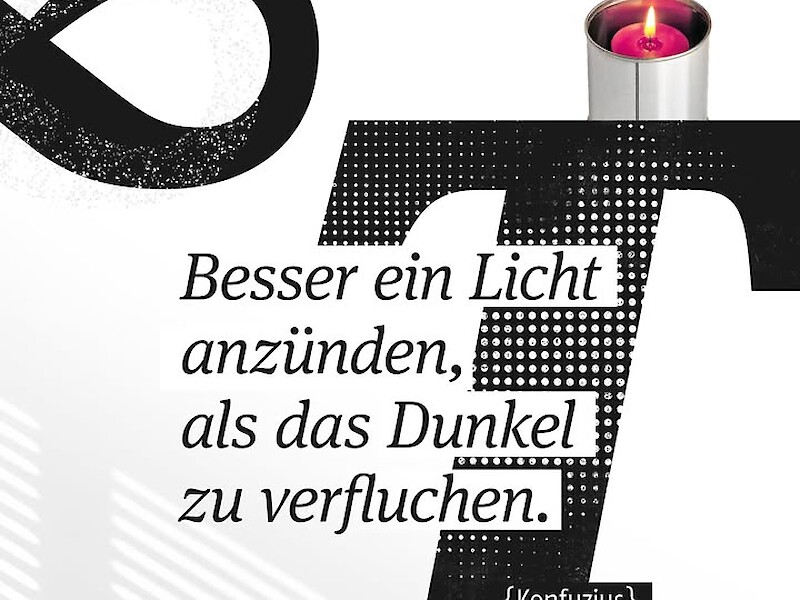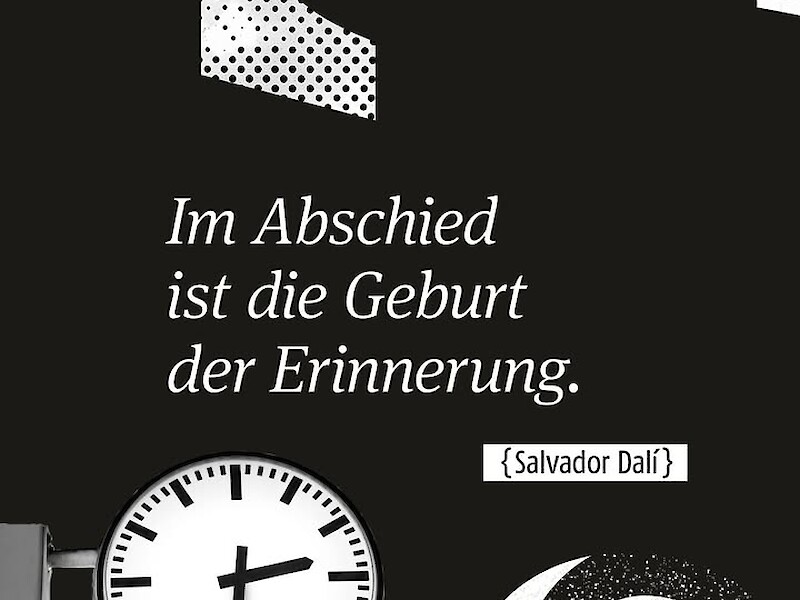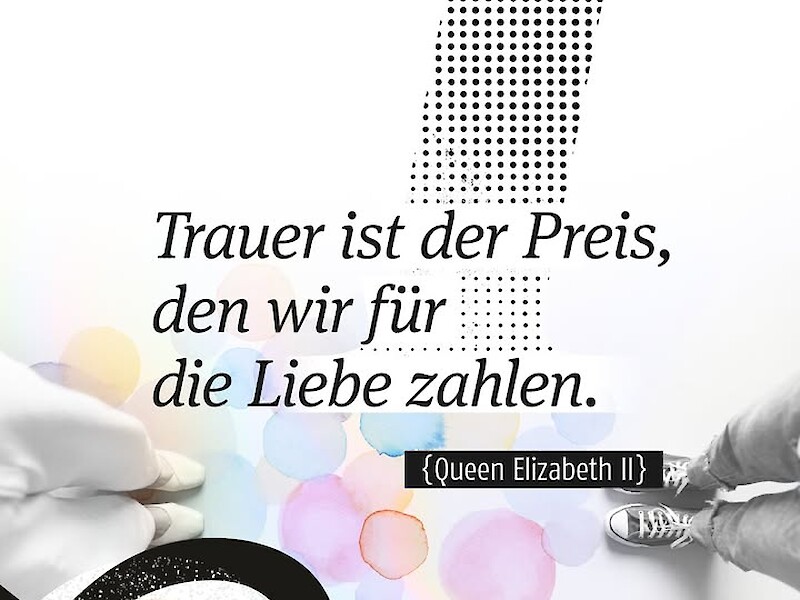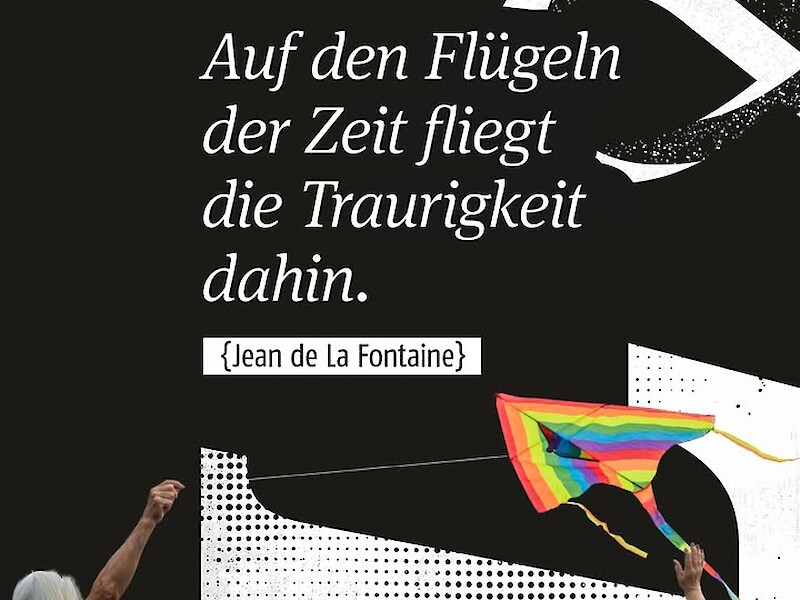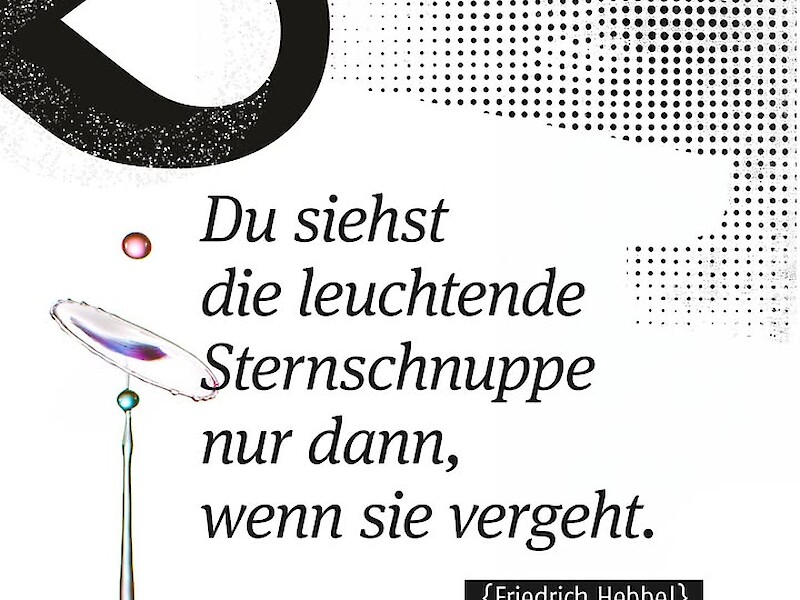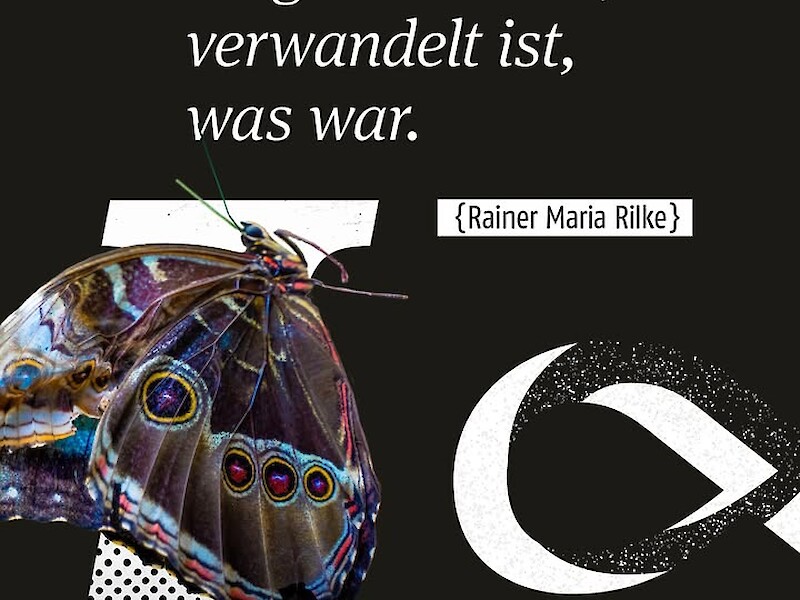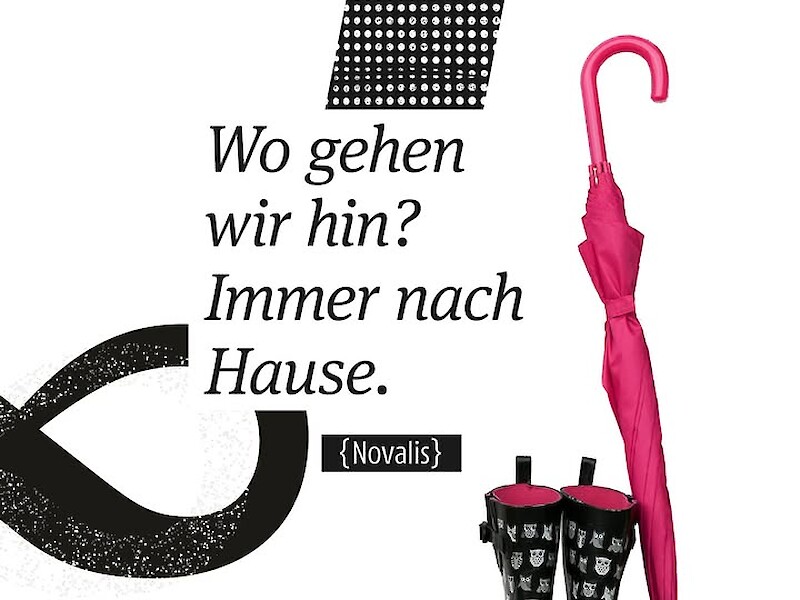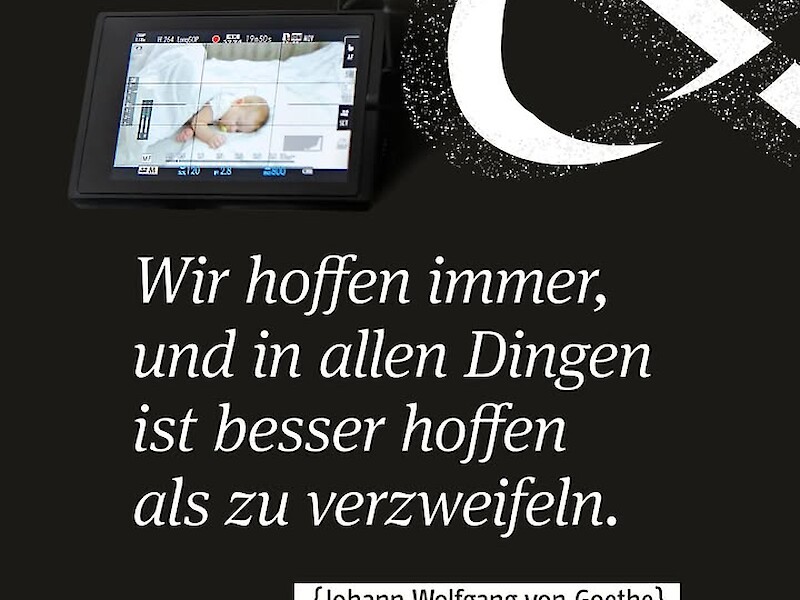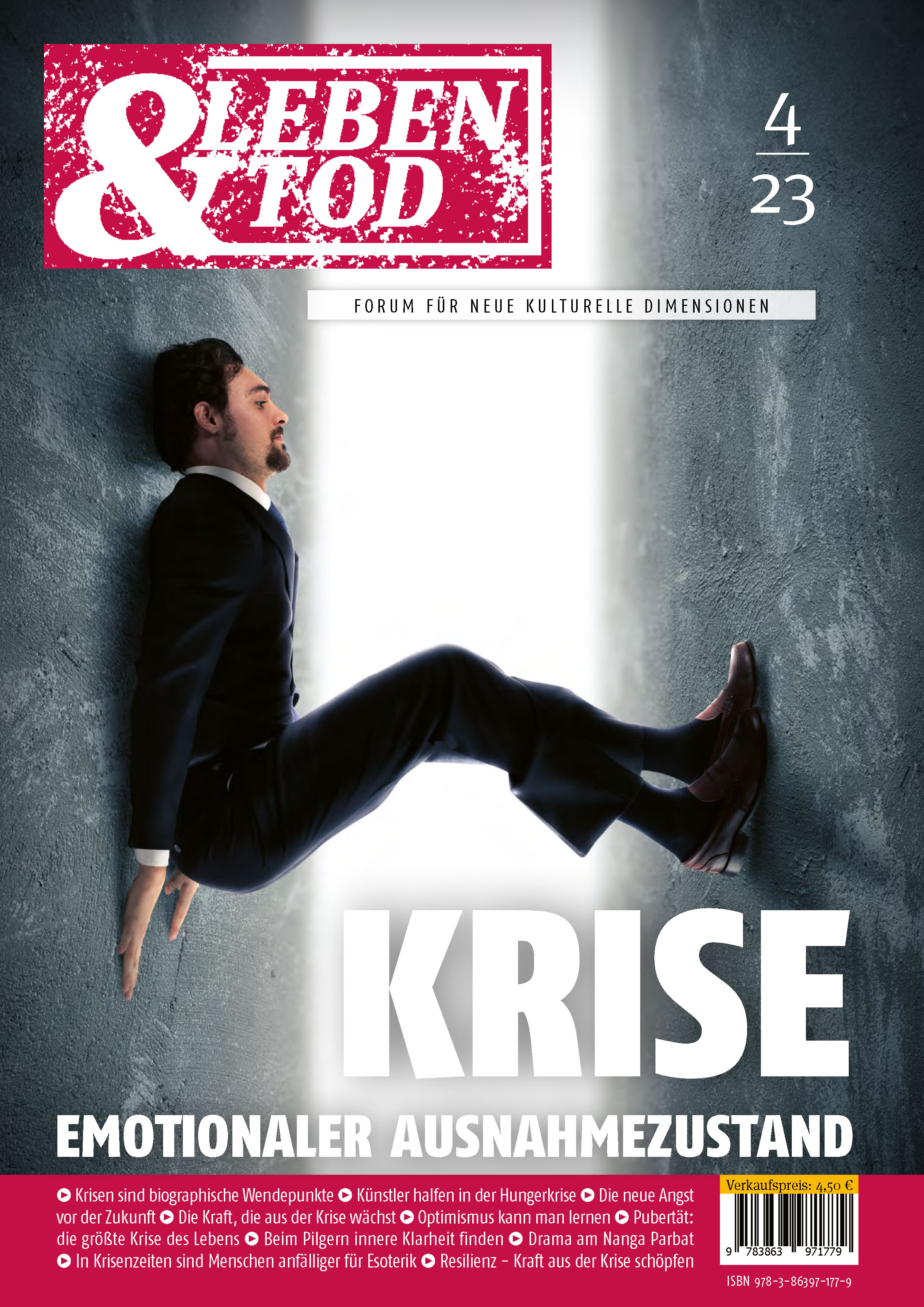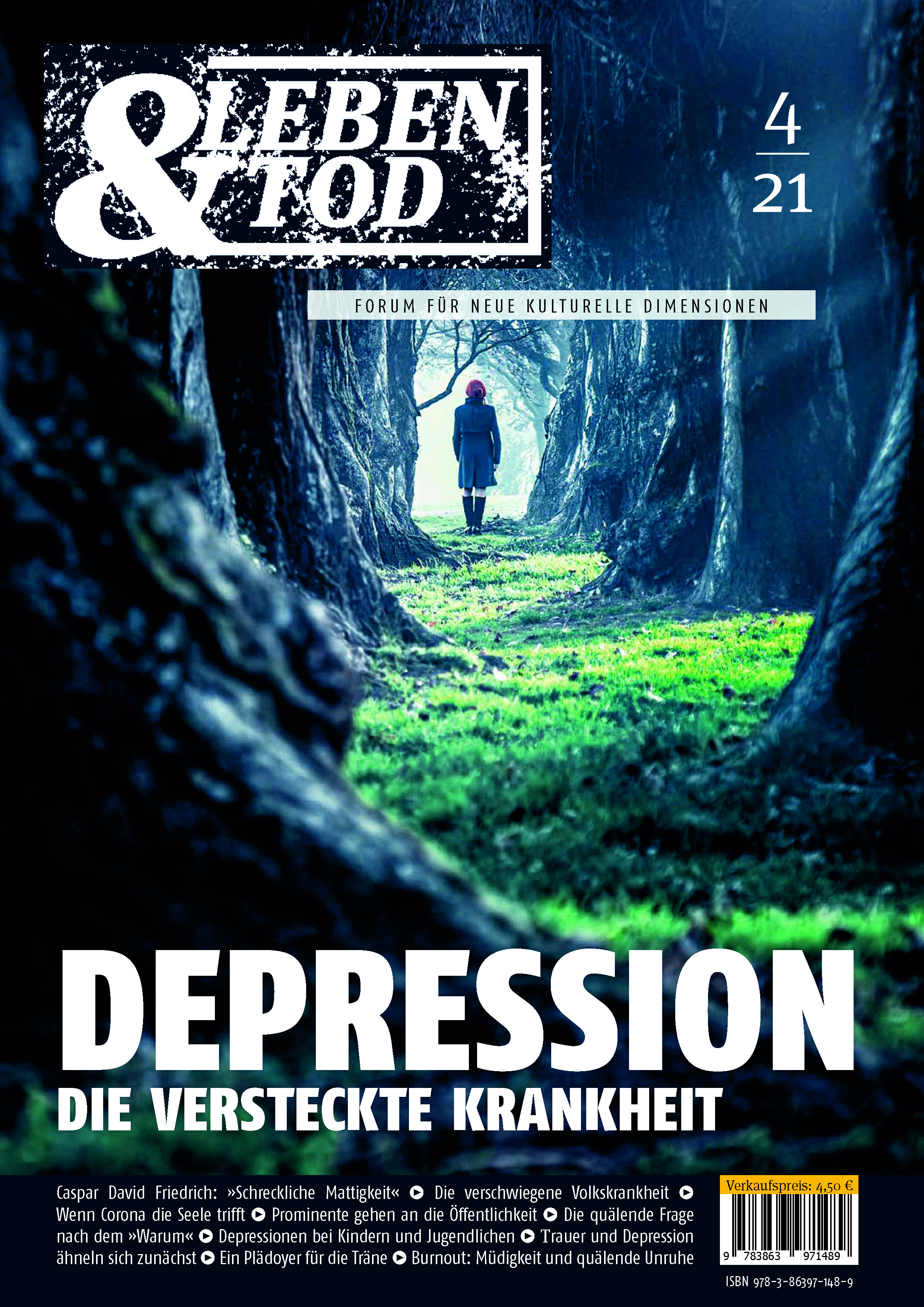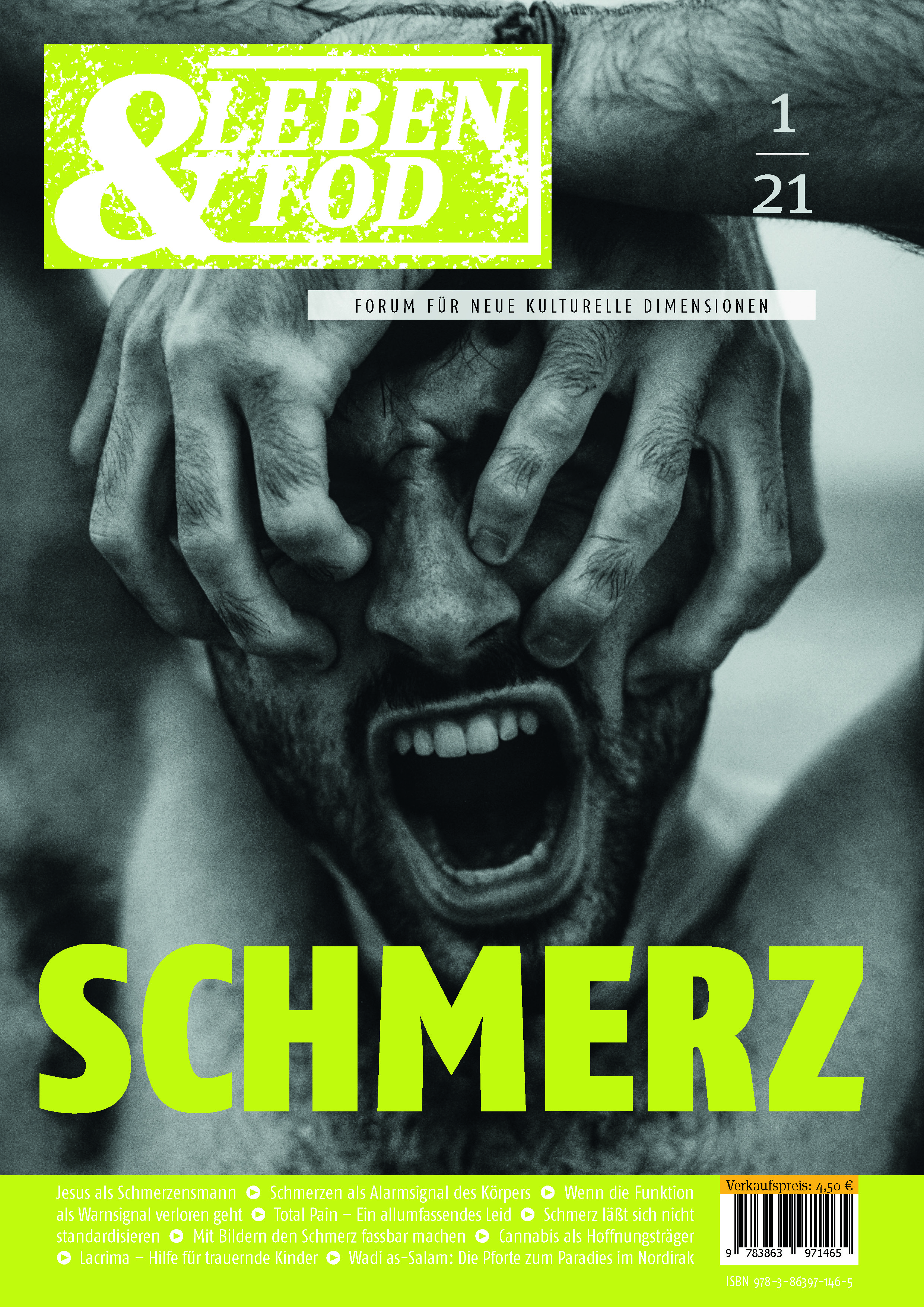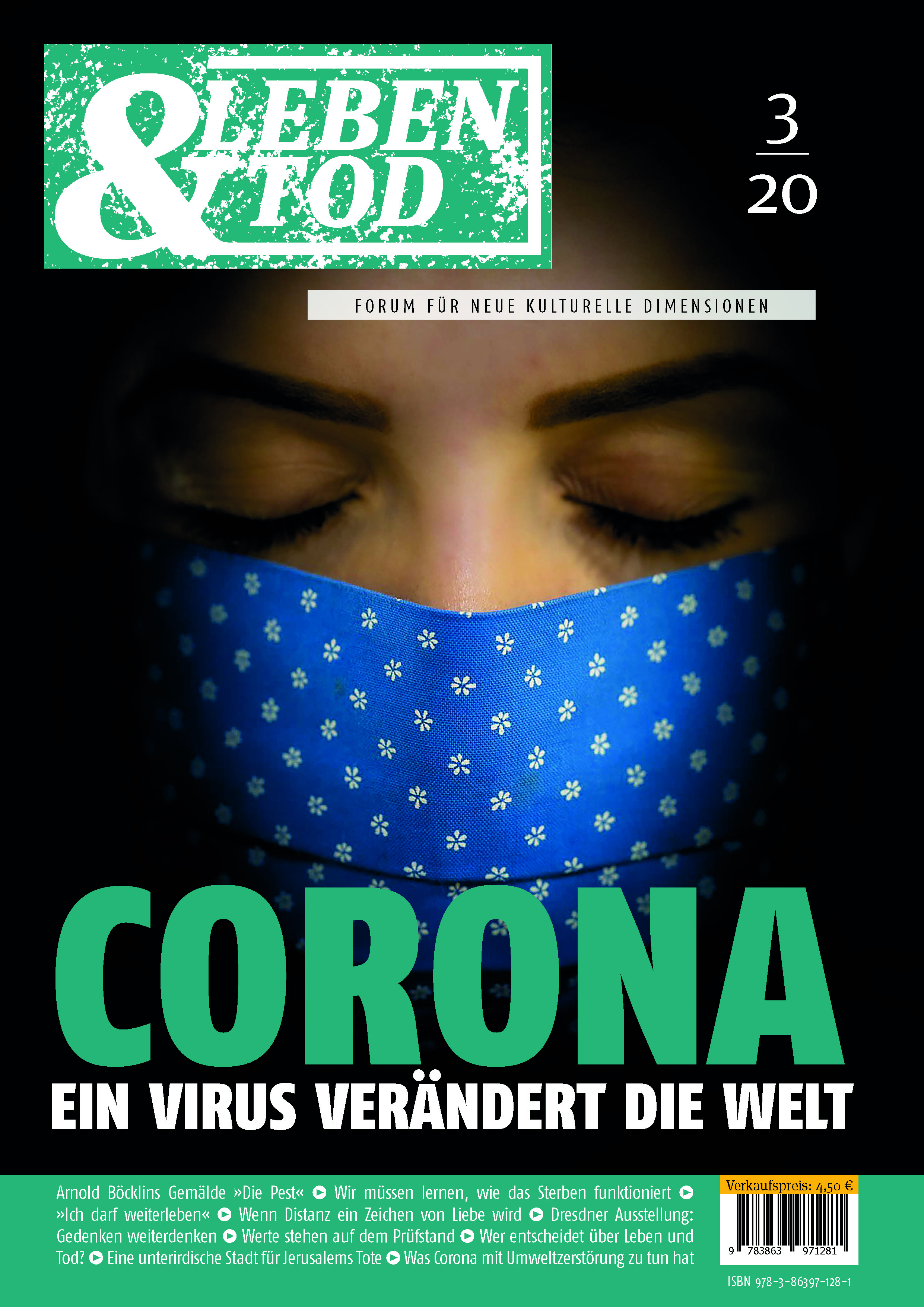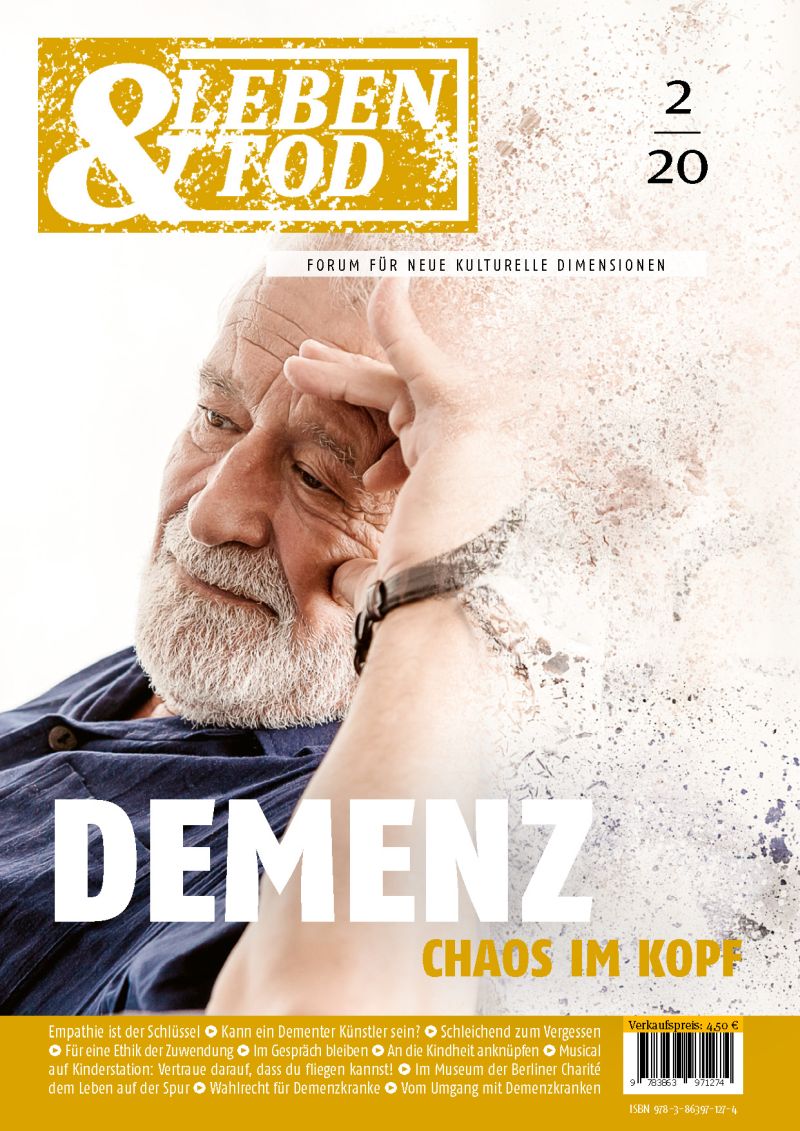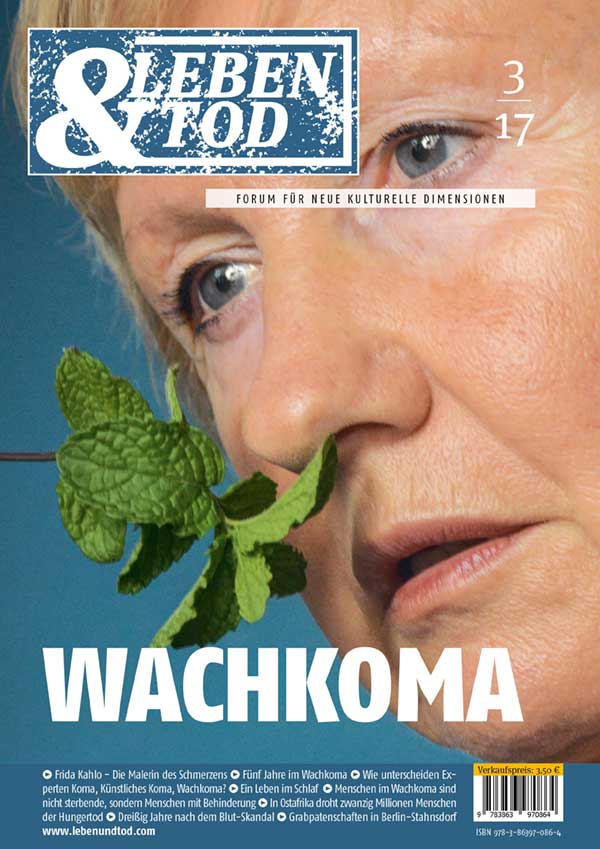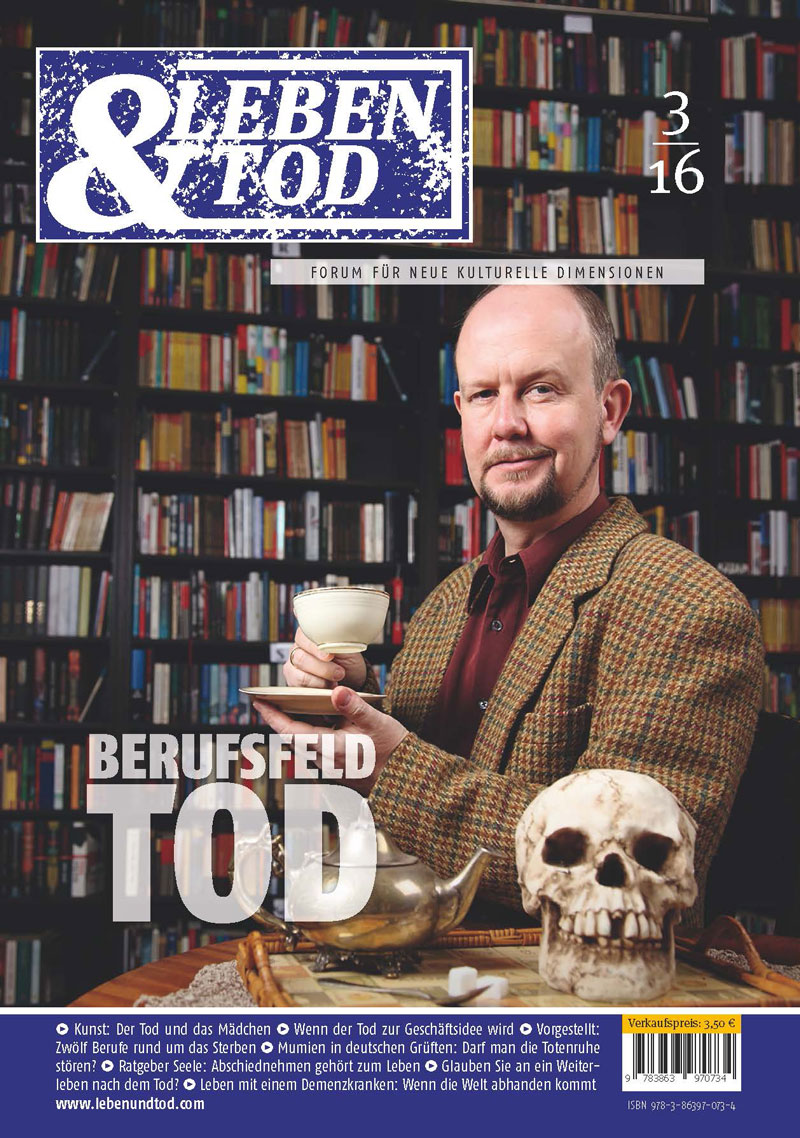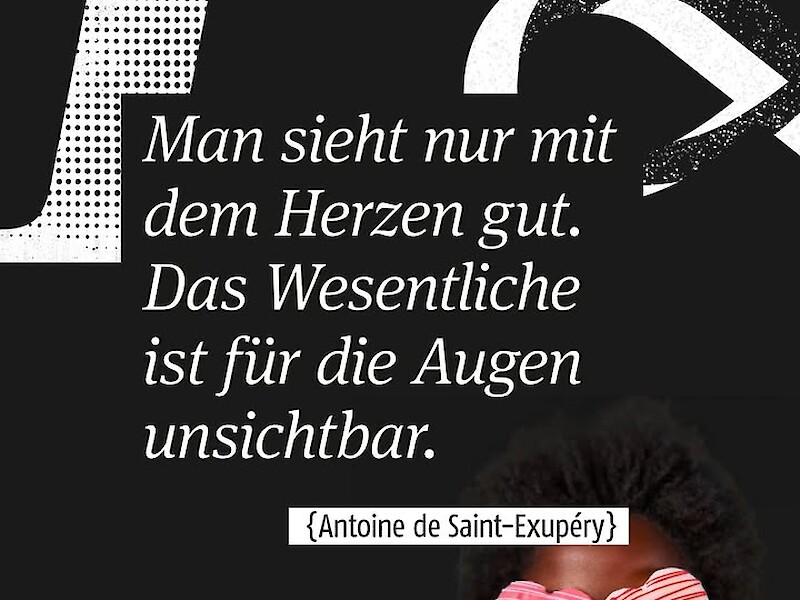
Aktuell
Termine
Social Media
Presseschau
- 01.10.201801Okt2018Schweizer können Haltung zur Organspende in Datenbank eintragenweiterlesen
- 30.08.201830Aug2018Wenn Maschinen über Leben und Tod entscheidenweiterlesen
- 30.08.201830Aug2018Mehr Rente durch ehrenamtliche Pflegeweiterlesen
- 27.08.201827Aug2018Abgeordnete uneins über Widerspruchslösungweiterlesen
- 03.06.201803Jun201810.000 Menschen warten auf Hilfeweiterlesen
- 17.05.201717Mai2017Der Tod als letzte Therapieweiterlesen
- 01.12.201601Dez2016Meilenstein oder Einschränkung?weiterlesen
- 29.11.201629Nov2016Italienerin feiert 117. Geburtstagweiterlesen
- 15.11.201615Nov2016Tod ist rechtlich keine Krankheitweiterlesen
- 15.11.201615Nov2016Vorwürfe gegen UKE erschüttern Experten und Politikweiterlesen
- 04.11.201604Nov2016100 Millionen Euro für nichtsweiterlesen
- 21.10.201621Okt2016So ist die Lebenserwartung in Ihrem Bundeslandweiterlesen
- 19.10.201619Okt2016Die letzten Stunden am liebsten daheimweiterlesen
- 19.10.201619Okt2016Kein »süßer Tod« in Deutschlandweiterlesen
- 13.10.201613Okt2016Alte Menschen sollen sterben dürfenweiterlesen
- 04.10.201604Okt2016Künstliche Ernährung am Lebensendeweiterlesen
- 28.09.201628Sep2016Zehntausende Frauen sterben jährlich bei Abtreibungenweiterlesen
- 26.09.201626Sep2016Ein Meister des Todesweiterlesen
- 17.09.201617Sep2016Erstmals Sterbehilfe für Minderjährige geleistetweiterlesen
- 27.08.201627Aug2016»Die Ärzte verdienen am Sterben«weiterlesen
- 25.08.201625Aug2016Italien erlebt erneut Trauma von L'Aquilaweiterlesen
- 24.08.201624Aug2016Millionen Deutsche müssen ihre Pflege neu regelnweiterlesen
- 23.08.201623Aug2016Im Sterben sind wir alle Analphabetenweiterlesen
- 22.08.201622Aug2016So geht Urlaub von der Pflegeweiterlesen
- 16.08.201616Aug2016Die Musik bleibtweiterlesen
- 15.08.201615Aug2016Ein Kopf auf einem fremden Körperweiterlesen
- 28.07.201628Jul2016Lieber ermordet werden als an Krebs sterbenweiterlesen
- 25.07.201625Jul2016Nach diesem Ball will die 14-jährige Jerika Bolen sterbenweiterlesen
- 09.07.201609Jul2016Das Menschenmuseum in Berlin liegt im Sterbenweiterlesen
- 09.07.201609Jul2016Der Tod im Livestreamweiterlesen
- 13.06.201613Jun2016Dresdner Mediziner schaffen Killerzellen gegen Krebsweiterlesen
- 31.05.201631Mai2016Cap-Anamur-Gründer Rupert Neudeck ist totweiterlesen
- 24.05.201624Mai2016Jede Minute sterben 250 Menschenweiterlesen
- 23.05.201623Mai2016Ganze Generationen sterben an Aidsweiterlesen
- 19.05.201619Mai2016Der letzte Mensch aus dem 19. Jahrhundertweiterlesen
- 16.05.201616Mai2016Tod und Kommerzweiterlesen
- 14.05.201614Mai2016Geburtshilfe-App für die Bambushütteweiterlesen
- 27.04.201627Apr2016Jeder Fünfte würde vor dem Ruhestand sterbenweiterlesen
- 18.04.201618Apr2016Rembrandt malt neues Bildweiterlesen
- 15.04.201615Apr2016Zu viele Nieren für zu viele Bulgarenweiterlesen
- 13.04.201613Apr2016Wenn ein lebensrettendes Projekt zu sterben drohtweiterlesen
- 13.04.201613Apr2016Flucht in den Todweiterlesen
- 12.04.201612Apr2016»Bevor ich jetzt gehe«weiterlesen
- 07.04.201607Apr2016Douglas muss sterbenweiterlesen