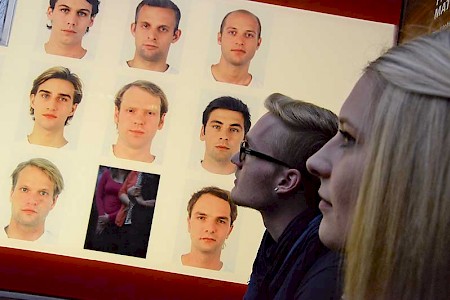Die Eizelle. So groß wie der Punkt am Ende des Satzes. Ein Vergleich, mit dem Florian Rensch etwas anfangen kann. Seine Lehrerin hat gefragt, wer die Dimension des Ursprungs menschlichen Lebens denn einschätzen könne. Dabei steht sie vor einem riesigen Modell im Deutschen Hygiene-Museum. »Leben und Sterben« heißt der Teil der Dauerausstellung »Abenteuer Mensch«, die dort seit zehn Jahren zu sehen ist. Manche Neuerung hat sie derweil erlebt, die meisten Exponate aber wirken ebenso zeitlos wie die Fragen im Fokus der Schau. Davon sollen die jungen Leute, die in die Ausstellung kommen, möglichst viele sammeln. Fragen, die sie mit nach Hause nehmen, die sie noch lange bewegen, über die sich mit anderen austauschen lässt...
Sie lesen die Vorschau
Sie haben diese Ausgabe gekauft oder ein digitales Abo?
Dann melden Sie sich an, um den vollständigen Artikel zu lesen.
Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe {ausgabe}.